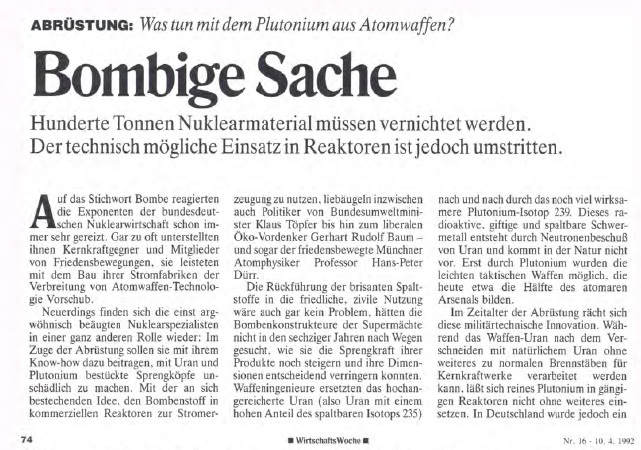Mit nobel schwarz gestylten Billiggeräten lehrt ein Mann namens Manfred Schmitt Computergrößen wie IBM, Compaq oder Vobis das Fürchten. Seine Erfolgsmarke Escom kennt jeder Pennäler, er selbst scheut die Öffentlichkeit.
Siemens-Nixdorf ist er ganz dicht auf den Fersen. Compaq, den einstigen Superstar der Personalcomputer-Branche, hat er bereits im vorigen Jahr knapp überrundet. Nur der mächtige EDV-Gigant IBM und die Kaufhof-Metro-Tochter Vobis Microcomputer AG halten den Außenseiter noch auf Distanz: Manfred Schmitt, Schöpfer des neuen Trend-PC Escom und erfolgreicher Newcomer auf dem deutschen EDV-Markt.
Heimlich, still und leise hat der als introvertiert, ja verschlossen geltende Unternehmer mit seiner Escom-Gruppe ein regelrechtes Firmenimperium aus dem Boden gestampft, vor dessen aggressiver Preispolitik mittlerweile bundesweit der Bürofachhandel zittert. In Ostdeutschland ist Schmitt über vier GmbH-Beteiligungen (drei davon mehrheitlich) ebenso präsent wie in sämtlichen Ballungsräumen der alten Bundesländer. Die Liste seiner Standorte reicht von Aachen bis Zwickau. „Unternehmen wie Schmitt und Vobis“, konstatiert Branchenkenner Manfred Frey, Geschäftsführer der Kronberger EDV-Marktforschungsgesellschaft IDC Deutschland GmbH, „reißen zunehmend den deutschen PC-Markt an sich.“
Dabei endet der Expansionsdrang des agilen Mittelständlers nicht an der deutschen Grenze. Schmitt kontrolliert nationale Vertriebsgesellschaften in Österreich, Ungarn und der Tschechoslowakei (CSFR) mit zusammen 28 Filialen. Demnächst will er auch noch Polen mit 20 Billig-Computerläden beglücken. Nicht zuletzt gehört zu den ehrgeizigen Ausbauplänen ein einheitlicher Auftritt mit einem klaren Firmenimage – ein Novum im Hause Schmitt.
Denn bis heute regiert in den Filialen des Heppenheimer Unternehmens die schiere Unauffälligkeit. Die meisten der Verkaufsstationen tragen noch immer das alte Logo „Schmitt Computersysteme“ und unterscheiden sich – zumindest für den unbefangenen Laufkunden – in nichts von den Dutzenden x-beliebiger PC-Krauterläden, die sich allerorten in Bahnhofsnähe breitmachen. Das einzig Bemerkenswerte in den Ausstellungsräumen sind die vielen pechschwarzen Computer, Monitore und Drucker.
Die Anonymität der Läden ist durchaus kein Zufall. „Ich bin kein Publicity-Typ“, kokettiert Manfred Schmitt mit seinem gewollten Mangel an Profil, „Ich kann gut damit leben, daß mich keiner kennt.“ Aus der Sorge, jede Form von Öffentlichkeitsarbeit würde vor allem die Konkurrenz auf den Plan rufen, mied der Querdenker bisher konsequent das Rampenlicht: keine Pressekonferenzen, keine Messeauftritte, statt dessen Kampfpreise, die seine örtlichen Dependancen bei Computerfreaks schnell zu Geheimtips werden ließen.
Inzwischen hat sich der Name so weit herumgesprochen, daß sich diese Guerillataktik nicht mehr durchhalten läßt. Allerdings will sich „Schmittchen Schleicher“ auch gar nicht länger verstecken – die Aufbauphase ist ja abgeschlossen. „Wenn die Mitbewerber endlich merken, daß man da ist,“ trumpft er auf, „ist es zu spät.“ In der Tat: Heute sind seine Escom-Modelle sogar in Großunternehmen wie Daimler-Benz, BASF und Hoechst zu finden, die sich früher ausschließlich bei IBM, Siemens oder Nixdorf eindeckten.
Der Mann, der sich anschickt, dem aggressiven Branchenprimus Vobis die Rolle als Preisbrecher im bundesdeutschen Computerhandel streitig zu machen, hat mit den typischen Exponenten dieses Metiers nur äußerst wenig gemein. Manfred Schmitt entspricht weder dem Klischee des schnoddrigen Turnschuhträgers noch dem des geschniegelten Smartie im blauen Nadelstreif. Auch ist er weder Informatiker noch MBA. Eher wirkt er wie eine deutsche Edition von Richard Clayderman (der wie er recht gut mit dem Klavier umgehen kann) mit einer Nuance Gérard Dépardieu: für seine 42 Jahre noch sehr jungenhaft und dabei so adrett, daß er selbst in Hemdsärmeln noch eine zurückhaltende Eleganz vermittelt.
Schmitt sitzt an der Spitze des mächtigen, schwarzen Tisches, der sein asymmetrisches Besprechungszimmer beherrscht – eines dreieckigen Ungetüms, in dessen Mitte ein künstlicher Bach im Endloskreislauf über echtes Gestein plätschert – und kramt in seinen Erinnerungen. „Ich will nicht sagen, daß ich untalentiert war“, erzählt der Computertycoon von seiner erträumten Karriere als Musiker, „aber zu einem der zehn besten Konzertpianisten auf der Welt, die wirklich gut verdienen, hätte ich es auch nie gebracht.“ Dabei beherrschte er schon mit 19 das „Wohltemperierte Klavier“.
Die Vorstellung, über kurz oder lang in einem Kurorchester zu enden, erscheint dem jungen Klavierenthusiasten jedenfalls derart abschreckend, daß er diesen Berufswunsch schnell ad acta legt. Umso bodenständiger ist das Studium, für das sich Manfred Schmitt dann entscheidet: Er will Wirtschaftsingenieur werden.
Doch die Musik läßt den Studenten nicht los: Um nicht mit dem kargen Bafög-Satz auskommen zu müssen, gibt Schmitt nebenbei Klavierstunden, erkennt in den langsam populär werdenden Hammondorgeln seine Marktnische und gründet bald in der Darmstädter Altstadt seine eigene Orgelschule. Der Zulauf zu seinen preiswerten Gruppenkursen ist beachtlich, und weil ihn immer wieder Schüler fragen, wo man denn günstig die elektronischen Instrumente kaufen könne, eröffnet der junge Mann 1972 – mit 22 – sein erstes, kleines Musikgeschäft.
Nach wenigen Jahren ist er als „Orgel-Schmitt“ – mit Filialen in Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Koblenz – nach eigener Einschätzung der größte Orgelhändler in Deutschland. Ganz nebenbei entwickelt der Freizeitunternehmer gemeinsam mit seinem Mainzer Filialleiter ein neuartiges Lehrbuch für den Orgelunterricht, das ihm noch viele Jahre später fünfstellige Tantiemen einbringt. Das ungeliebte Studium hängt er nach dem Vordiplom an den Nagel.
Als Ende der siebziger Jahre die computergesteuerten Synthesizer auf den Markt kommen, mit denen sich alle möglichen Instrumente auf demselben Keyboard simulieren lassen, ist der nächste Schritt vorgezeichnet: Es dauert nicht lange, da halten bei Orgel-Schmitt die Heimcomputer Einzug, anfangs noch als Zubehör. Und während die Nachfrage nach den neuen elektronischen Spielzeugen unaufhörlich steigt, geht das angestammte Geschäft mit den Musikalien immer mehr in den Keller. 1985 dann die Konsequenz: Aus „Orgel-Schmitt“ wird „Schmitt Computersysteme“.
Vom legendären Commodore 64, der zu jener Zeit in keinem besseren Jugendzimmer fehlen darf, verkauft Schmitt zwar eine „gigantische Stückzahl“. Doch er muß die Erfahrung machen, daß an diesem 598-Mark-Produkt kaum etwas zu verdienen ist. Die Rendite bessert sich erst, als Commodore-Gründer Jack Tramiel die angeschlagene US-Videospiel-Firma Atari Corp. saniert und dem Handel mit neuentwickelten Homecomputern auskömmliche Margen bietet. Natürlich drängt es Schmitt erneut nach einer Superlative: „Wir waren damals der größte Atari-Händler in Deutschland.“
Allerdings nur für kurze Zeit. Denn inzwischen zeichnen sich im Markt der billigen Hobby-Rechner bis zu 1000 Mark deutliche Sättigungstendenzen ab, während höherwertige Profi-Systeme – vor allem Apple und die IBM-kompatiblen – zunehmend auch von Privatkunden gekauft werden. Schmitt orientiert sich an den USA: Dort erobern inzwischen die sogenannten Clones immer größere Marktanteile, namenlose Nachbauten, auf denen die gleiche Software läuft wie auf den IBM-Personalcomputern im Büro. Die meist in Fernost gefertigten Rechner kosten in amerikanischen Cash’n’carry-Märkten bis zu 50 Prozent weniger als bekannte Fachhandelsmarken wie IBM, Compaq oder AT&T/Olivetti.
Als einer der ersten deutschen Computerhändler setzt Schmitt auf die No-names. 1987 verabschiedet er sich, wie ein Branchenveteran sich erinnert, mit einem wahren Preisgemetzel von der Atari-Produktlinie – und widmet sich voll dem Geschäft mit den IBM-Kompatiblen. Doch der Ex-Orgelhändler, der nun mit einer fünfköpfigen Firmenzentrale in einem Wiesbadener Hinterhofbüro residiert, verramscht nicht einfach irgendwelche Taiwan-Importe. Er schraubt seine Computer selbst zusammen. Und weil er ahnt, daß er nun den Grundstock zu einem enormen Wachstum gelegt hat, engagiert Schmitt kurzerhand seinen cleveren Kundenberater von der Hausbank BHF als Finanzchef.
Fabrikationsstandort ist zunächst die Gemeinde Höchst im Odenwald. Bald kommen zusätzliche Montagestraßen hinzu, und Ende 1991 beginnt der Umzug von Verwaltung, Produktion und Lager in die ehemalige Honeywell-Computerfabrik in Heppenheim. In der Empfangshalle dokumentiert eine Bronzetafel aus dem Jahre 1968 die große Vergangenheit des von außen völlig schmucklosen Zweckbaus – Symbol für den dramatischen Strukturwandel in der EDV-Industrie, bei dem kaum einer der traditionellen Hersteller ungeschoren geblieben ist.
Schmitts Kalkulation gleicht der eines Generika-Produzenten … la Ratiopharm in der Pharmaindustrie: Weil die Geräte in Minutenschnelle aus standardisierten Bauelementen zusammengesetzt werden können, fallen für den Clone-Hersteller weder Entwicklungskosten noch Lizenzgebühren an. Statt dessen lautet das inzwischen vielfach kopierte Patentrezept: geringstmögliche Fertigungstiefe, reine Endmontage. „Die Innovation ist Sache des Festplattenherstellers, des Boardherstellers und des Prozessorherstellers“, formuliert Manfred Schmitt sein Glaubensbekenntnis, „Eigenentwicklung wäre in diesem Geschäft tödlich.“ Was Technik angeht, schwimmt er deshalb lieber mit dem Strom: Wer mit austauschbaren Komponenten arbeitet, kann sich jederzeit von šberbeständen befreien und bei Engpässen auf alternative Lieferanten zurückgreifen.
Die Baugruppen kauft der Unternehmer in aller Welt zusammen: Billige Bestandteile wie Gehäuse und Bildschirme werden langfristig disponiert und auf dem Seeweg aus Ostasien importiert, teure Komponenten wie Prozessorchips und Speichermodule kommen per Luftfracht. Mit dieser zweigleisigen Einkaufspolitik reduziert Schmitt nicht nur das tote Kapital. Er sichert sich auch gegen die in diesem schnellebigen Markt häufigen Preiseinbrüche ab und verkürzt seine Reaktionszeit.
Um sich von der Konkurrenz abzuheben, setzt Schmitt heute neben den knallhart kalkulierten Verkaufspreisen für die jeweils neueste technische Generation vor allem auf ein unverwechselbares Design. Es nennt sich „Blackmax“, „Blackmate“ oder „Black Magic“ – und das bedeutet nichts anderes, als daß viele der Produkte mit dem Eigenlabel Escom auf Wunsch im schwarzen Gehäuse erhältlich sind. Auch die Peripherie, etwa Fujitsu-Drucker oder Bildschirme mit Sony-Trinitron-Bildröhre, läßt Schmitt in Schwarz produzieren. Das kostet im Einkauf nicht viel mehr, verleiht der billigen Hausmarke aber einen Hauch von Exklusivität.
Die Nichtfarbe Schwarz steht im Mittelpunkt der Corporate Identity, die der Frankfurter Art Director Franz Reiter (Reiter & Partners) für den ehemaligen Nobody Schmitt entworfen hat. „Schwarz ist keinen Moden unterworfen“, doziert der Reiter-Kunde, als sei die Idee von ihm, „aber die Farbkombination muß stimmen.“ In Schmitts schwarzem Konferenzraum mit dem schwarzen Wasserspiel-Tisch bestehen diese Farbtupfer aus abwechselnd knallroten, knallgelben, knalltürkisen und schwarzen Designerstühlen sowie aus vielen kleinen Quadraten in denselben Tönen, die man eigens in den schwarzen Teppichboden eingewebt hat.
Ein solch extravagantes Ambiente hebe die Motivation seiner Familie, glaubt der Junggeselle, wobei er mit „Familie“ die Belegschaft seiner Zentrale meint. Deshalb hat der Boß, der hier während seiner Sechstagewoche selbst bis zu 80 Stunden zubringt, neben den 20 Millionen Mark für die Immobilie schnell noch einmal zwei Millionen für den Innenarchitekten lockergemacht. Außen ist der Bau nach wie vor pfui, innen aber mega-hui. So rinnen jetzt im Treppenhaus hintergrundbeleuchtete Wasserfälle über schwarzes Gestein, und als Gipfel der Designerkunst protzt neben dem besagten dreieckigen Tischensemble ein Poolbillard aus Acrylglas.
Reiters kesse Handschrift zeigt sich natürlich auch im Werbeauftritt: Kühles Schwarzweiß und Knallrot als Blickfang sind die Erkennungsfarben der Broschüre „Escom Extra“, die seit Herbst 1991 alle zwei Monate zehn Millionen deutschen Tageszeitungslesern vor die Füße fällt, wenn sie die Reklamebeilagen herausschütteln. Der Art Director hat seine Aufgabe bravourös gemeistert, einen Kontrapunkt zum Prospekt des Marktführers zu setzen. Verglichen mit dem typographisch sauberen Escom Extra sieht nämlich der „Denkzettel“ des großen Rivalen Vobis aus wie eine kunterbuntes Potpourri aus dem Schriftmusterbuch.
Weil aber die Bekanntmachung von Preisen noch keine zufriedenen Kunden bringt, soll die Umbenennung der „Schmitt Computersysteme“ in „Escom Office“ mit einem „gnadenlosen Schulungsprogramm“ für das Ladenpersonal einhergehen. Galt bisher für den preisbewußten Schmitt-Kunden die Parole „Vogel, friß oder stirb!“, sollen ihm die Verkäufer künftig „den Eindruck geben, daß so was wie Service existiert“ (Schmitt). Um diese Imagekampagne zu unterstützen, lädt der Odenwälder Schwarz-Händler neuerdings sogar sämtliche im Preis enthaltene Software bereits im Werk in den Computer. Mit dieser lästigen Arbeit müssen sich die meisten Rechnerkäufer bisher selbst herumärgern.
Das Profil, um das sich Schmitt an der Kundenfront derzeit so massiv bemüht, hat er bei seinen Lieferanten schon erlangt. So zahlte es sich aus, daß der findige Hesse frühzeitig auf den Tintenstrahl-Drucker der Hewlett-Packard GmbH (HP) gesetzt hatte: Als nach einem positiven Testbericht die Nachfrage unerwartet in die Höhe schnellte, revanchierte sich HP mit einer dem vorherigen Abverkauf entsprechenden Warenzuteilung. So war Schmitt in vielen Städten als einziger Händler lieferfähig.
Für den amerikanischen Intel-Konzern, dessen Prozessorchips in den meisten Escom-Rechnern stecken, ist Schmitt sogar binnen weniger Jahre von einem unbedeutenden Provinzhändler zu einem der wichtigsten Abnehmer in Deutschland geworden. Schließlich baut er 80000 Computer im Jahr. Wenn Schmitt mit dem Konkurrenten Advanced Micro Devices fremdgeht, ist dies inzwischen ein Anlaß für Intel-Chef Andrew Grove, sich persönlich um den Heppenheimer zu kümmern.
Für Conner Peripherals, einen der führenden und schnellstwachsenden Hersteller von Computer-Speicherplatten in den USA, ist Escom-Alleinaktionär Manfred Schmitt sogar die Nummer eins. Die hundertprozentige Escom-Tochter Peripherals Europe GmbH fungiert neuerdings als „Master Distributor“ für den deutschsprachigen Markt und ganz Osteuropa. Chairman Finis Conner erhofft sich von dem Deal, daß Schmitt bereits im ersten Jahr eine Million Festplatten in Europa absetzt. Ein verwegenes Ziel, doch der deutsche Partner glaubt, daß er’s schafft: „Wir streben mit der Distributions-GmbH aus dem Stand einen Umsatz von 200 bis 250 Millionen Mark an.“ Pikanterweise handelt es sich bei den potentiellen Kunden vor allem um regionale Schraubenzieherfabriken, also um mögliche Escom-Konkurrenten.
Und als wäre das alles nicht genug für eine Firma mit 500 Mitarbeitern, die ihr Wachstum auf voraussichtlich 600 Millionen Mark Jahresumsatz im Jahr 1992 doch irgendwie verkraften muß, drückt der Autofan und Formel-3-Sponsor Manfred Schmitt noch weiter auf die Tube. In Schottland hat er sich jetzt an einer Fabrik für Computermonitore beteiligt, die bis Ende 1993 einen Ausstoß von 70000 Geräten pro Monat erreichen soll. Das entspräche immerhin zehn Prozent Marktanteil in Europa und einem Jahresumsatz von weiteren 200 Millionen Mark. Außerdem will Manfred Schmitt seine Escom-Läden nach US-Vorbild als Softwarediscounter positionieren und eine wichtige Rolle im Geschäft mit Telekommunikations- und Multimedia-Produkten spielen.
Allerdings hat der Heppenheimer Turbo-Unternehmer bereits erkannt, daß er diese harte Expansionstour nicht mehr lange aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Doch selbst dieses Problem scheint gelöst: Im vergangenen Jahr gelang es Schmitt, den AG-Mantel der Stuttgarter Syntec AG zu kaufen, die in den achtziger Jahren mit Bürocomputern der Marke Eritron Schiffbruch erlitten hatte. Aus der Syntec AG wurde die Escom Computer AG, und nun ist nicht nur der Weg frei für den Gang an die Börse. Ganz nebenbei erwarb Schmitt auch noch 19 Millionen Mark Verlustvortrag. Einen Zeitplan für das „going public“ gibt es noch nicht. „Aber wir sind ready to go.“
In stark gekürzter Fassung erschienen in Capital 6/1992.